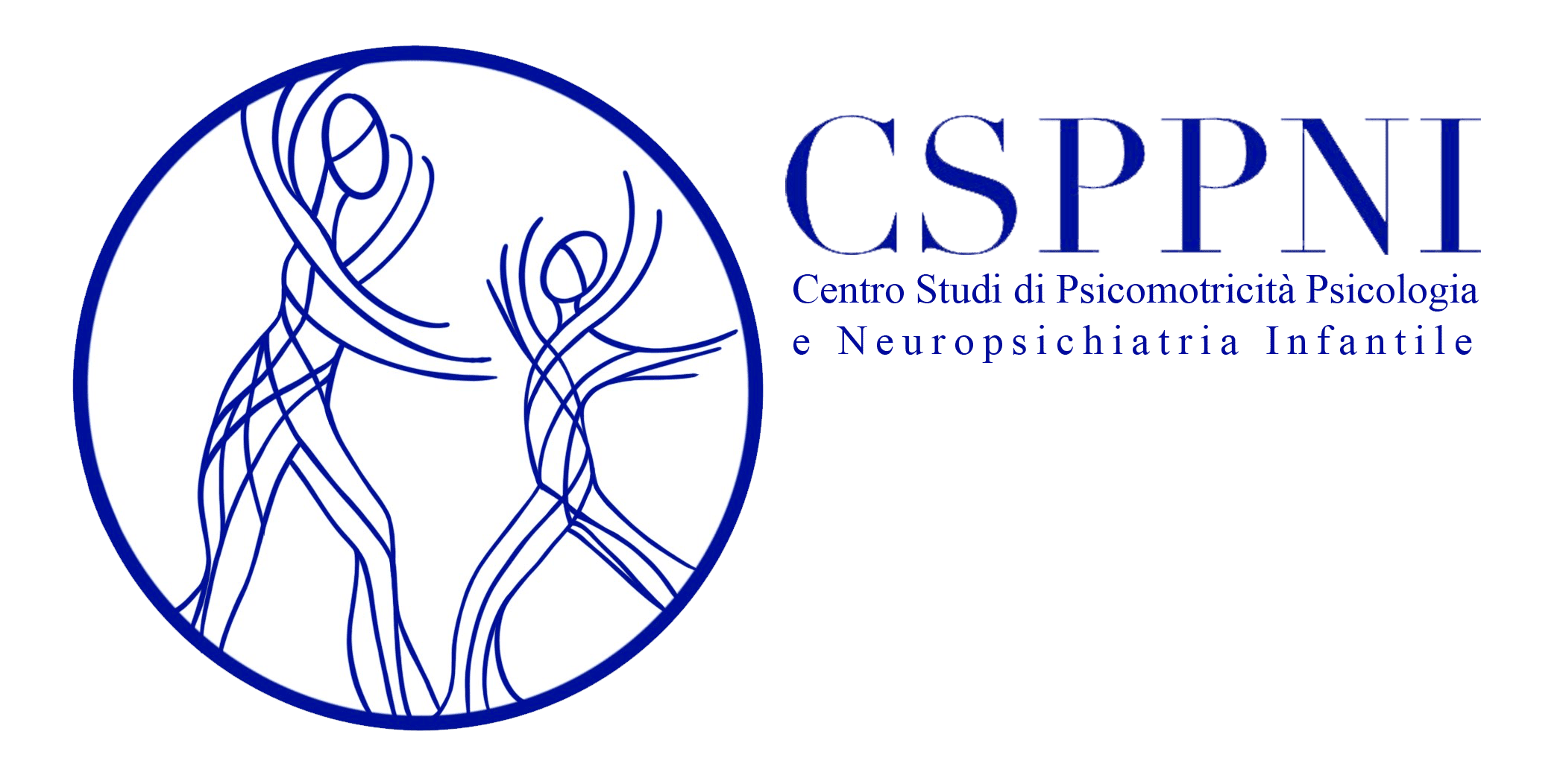Tutti noi ci portiamo dentro un’esperienza di famiglia o di comunità in cui siamo stati cresciuti. Da quell’esperienza positiva o negativa che sia, nasce il bisogno di generare e condividere con il proprio partner una nuova famiglia. All’interno di essa i singoli membri cercano riconoscimento e amore e, per i bambini e i ragazzi, queste istanze sono fondamentali per la costruzione del proprio sé. Si possono creare legami sani, ma anche disfunzionali, i genitori possono avere avuto una storia pesante alle spalle, non risolta, che può diventare ingombrante. Quando la sofferenza di un membro della famiglia può essere il catalizzatore delle sofferenze degli altri componenti, oppure la sofferenza di più persone del nucleo familiare diventano durature e perseveranti, può essere il momento di chiedere aiuto ad uno specialista.
 L’atto generativo, il desiderio di maternità e paternità, nelle diverse forme che gli attuali sviluppi scientifici permettono, è da sempre un istinto sano e naturale. Essere genitori in questo ultimo ventennio ha comportato una serie di trasformazioni della famiglia e del modo di fare i genitori: dalle modifiche dei ruoli genitoriali, dal demandare parte dell’educazione dei figli alle istituzioni, dalla presenza delle nuove tecnologie che hanno modificato il modo in cui li si crescono.
L’atto generativo, il desiderio di maternità e paternità, nelle diverse forme che gli attuali sviluppi scientifici permettono, è da sempre un istinto sano e naturale. Essere genitori in questo ultimo ventennio ha comportato una serie di trasformazioni della famiglia e del modo di fare i genitori: dalle modifiche dei ruoli genitoriali, dal demandare parte dell’educazione dei figli alle istituzioni, dalla presenza delle nuove tecnologie che hanno modificato il modo in cui li si crescono.
Questo tipo di intervento viene offerto ai genitori che si trovano in un momento di difficoltà nella crescita e nella comunicazione con il proprio figlio. I colloqui mirano a portare una maggiore consapevolezza degli stili educativi, non sempre concordanti tra i coniugi, a migliorare la comunicazione in famiglia e ad instaurare un vero dialogo con il figlio. Attraverso la condivisione di specifiche strategie e di strumenti idonei ai singoli componenti della famiglia, si potranno identificare percorsi di cura.
 La terapia familiare è un approccio che individua nelle convocazioni dell’intero nucleo familiare, o di alcuni suoi membri, insieme al paziente, sia esso bambino o adulto, una potente risorsa per il cambiamento e il miglioramento della sintomatologia psicologica.
La terapia familiare è un approccio che individua nelle convocazioni dell’intero nucleo familiare, o di alcuni suoi membri, insieme al paziente, sia esso bambino o adulto, una potente risorsa per il cambiamento e il miglioramento della sintomatologia psicologica.
Gli esseri umani si sviluppano e si muovono all’interno di reti di relazioni significative che contribuiscono ad influenzare il nostro cammino e a determinare una parte rilevante del nostro modo di essere nel mondo, delle nostre risorse e delle nostre fatiche. In quest’ottica sistemica, i sintomi sono intesi come una possibile modalità di comunicazione, per quanto disfunzionale, della sofferenza che il paziente sente, ma non è ancora in grado di esprimere direttamente in parole, e i familiari sono tra i destinatari privilegiati di questa comunicazione.
Gli stessi possono essere convocati dal terapeuta e, attraverso la “testimonianza”, possono essere di stimolo nell’arrivare ad una consapevolezza del problema, contribuendo con la loro visione alla definizione della difficoltà e alla ricerca collaborativa di una soluzione, specialmente quando questa problematica abbia radici primariamente relazionali.